
Digitalisierung belebt ländliche Kommunen
Das Credo der Zeit heißt: gleichwertige Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land. Doch es besteht die Gewissheit, dass es die nicht gibt. Es scheint immer noch zu wenig Vorstellungskraft darüber zu geben, was man gemeinwohlorientiert mit einer guten digitalen Infrastruktur anstellen kann, was das Dableiben im ländlichen Raum befeuert: Mobilität, Gesundheitsversorgung, Wohnen und Leben. Durchweg alle Bereiche des menschlichen Lebens sind berührt, mit dem Unterschied, dass es hier nicht selten ums Überleben oder Aufgeben geht. Die ländlichen Orte stehen vor der Entscheidung, sich selbst aktiver als bisher auf den digitalen Weg zu machen, ohne dabei ihre Traditionen und Eigenheiten aufzugeben. Es geht nicht mehr um das Ob, sondern um das Wie und wer anfängt. Aus den Fehlern der smarten Städte, die sich gern den Tech-Firmen verschrieben haben, kann der ländliche Raum lernen. Es ist nicht die Technik allein, es ist die soziale Interaktion, die das Gelingen einer digitalen Transformation überhaupt erst möglich macht. Sondern der Mensch.

Erst wenn Menschen Digitalisierung erleben, werden die Chancen sichtbar, wird das Potenzial erkennbar. Wir brauchen Orte, an denen das gelingt. Wir brauchen Experimentierräume, Reallabore, in denen innovative Ideen für ländliche Räume entwickelt, umgesetzt, gelebt und erprobt werden können. Diese Orte sind eingebettet in die ganz großen Themen: Klimawandel, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit - globale Themen verändern die Welt, nehmen aber ihren Ursprung noch im kleinsten Dorf und kehren als Ergebnis auch dorthin zurück. Neue Formen der Kooperation, der Koproduktion und Gemeinsamkeiten nehmen auch dort ihren Ursprung und tragen zur Veränderung bei. Die Vernetzung wird dabei zentral, insbesondere in einer Gesellschaft, die auseinander driftet. Ländliche Räume haben vor allem den Vorteil, dass der Zusammenhalt und die nachbarschaftlichen Kontakte noch bestehen und tragen. Daran gilt es anzuknüpfen. Im ländlichen Raum kann ein Neustart gelingen: Jedes Dorf, jede Kleinstadt oder Region ist eigen. Es braucht individuelle Herangehensweisen. Von unten vorangetrieben. Das gemeinwohlorientierte Denken greift, weil es zum Dableiben aller beiträgt. Streng genommen könnten sich Kommunen sogar dafür entscheiden, ganz auf digitalen Fortschritt zu verzichten. Kommune 0.0 als Modell etwa. Aber auch das setzt die Kenntnis über Transformationen voraus, um sich bewusst dagegen zu entscheiden.
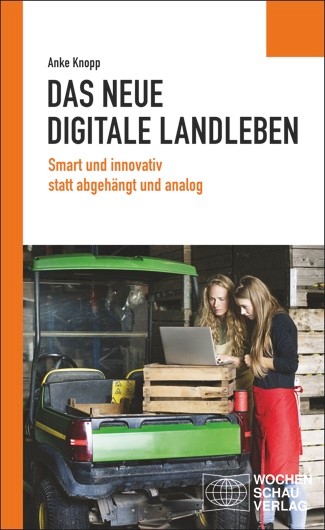
Digitalisierung kann einen neuen gesellschaftlichen Zusammenhalt erzeugen
Bisher lag es oft in den Händen weniger, Lösungen anzubieten. Es bedarf jedoch der Vielen, wenn Orte überleben wollen, etwa die Einheimischen, die Hinzugezogenen, die Rückkehrer, Menschen aus anderen Kulturkreisen, Alte und Junge. Neue Formen der Partizipation können experimentelle Ansätze entwickeln helfen. In den smarten Städten kamen die Impulse von oben verordnet, getrieben durch Geld. Der ländliche Raum kann dem menschlich-soziale Eigenheiten und Kompetenzen entgegen stellen. Das Einbinden beginnt bereits bei der Identifizierung von Bedarfen, es schließt sich die Kooperation und Koproduktion an. Das kann ein örtlicher Lieferdienst sein, ein Service für Demenzpatienten im ländlichen Raum - getragen durch die örtliche Gemeinschaft und hochgradig vernetzt etwa mit den Landfrauen, auch mit Hilfe künstlicher Intelligenz wie Robotern. Wenn alle mitmachen, entsteht ein neues Gefühl von gesellschaftlichem Zusammenhalt, das stärkt das Vertrauen auf Zukunftsfähigkeit aller. Und es lässt Kompetenz im Umgang mit der digitalen Welt entstehen und vor allem Raum für neue Lebenskonzepte, über die man heute vielleicht noch lächelt, die aber morgen zukunftstauglich sind. Das Dorfsterben hat Alternativen. Sie beginnen mit null und eins.




